Stiftungspreise 2025
Die 24. Preisverleihung der DEFA-Stiftung fand am 26. September 2025 in der Akademie der Künste statt. Der Gesamtwert der Preise betrug erneut 40.000 Euro.
Preisträger
- Preis für das künstlerische Lebenswerk: Gudrun Steinbrück-Plenert
- Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film: Laila Stieler
- Preis für junges Kino: Jan Soldat
- Programmpreis: KiKiLi – Kinderkino im Lingnerschloss, Dresden
- Programmpreis: Trickfilmkollektiv „Talking Animals“, Berlin
- Programmpreis: Latücht – Film und Medien e.V., Neubrandenburg
Zur Fotogalerie der 24. Preisverleihung.
Preis für das künstlerische Lebenswerk
Gudrun Steinbrück-Plenert

Gudrun Steinbrück-Plenert
Fotograf: Andreas Domma
Gudrun aus Halle an der Saale oder like a rolling stone
Es ist mir eine Freude, zu verkünden, der Preis der DEFA-Stiftung für das „künstlerische Lebenswerk“ in diesem Jahr an die unvergleichliche Schnittmeisterin Gudrun Steinbrück, vielen bekannt als Gudrun Plenert, geht. Den Namen Plenert hatte sie Ende der 1980er Jahre bei der Namensnennung auf dem Abspann mit ihrem Mädchennamen getauscht, um nicht in den Verdacht des Familienklüngels zu geraten. Den Großteil der Filme, die sie montierte, drehte der Kameramann Thomas Plenert, mit dem sie, bis zu seinem Tod, verheiratet war. Einen Doppelnamen zu führen, kam ihr nicht in den Sinn. Auch beharrt sie lange auf Ihrer Berufsbezeichnung Schnittmeister, Schnittmeisterin lässt sie noch gelten. (Als Fußnote: Prestigeverlust hatten in der DDR die Männer, wir Frauen, ihnen gleichgestellt, fanden die gleiche Berufsbezeichnung als Gewinn und somit gerecht.)
Im Juni rief mich Gudrun an: Ich soll den Preis der DEFA Stiftung bekommen, für mein Lebenswerk. Findest du das nicht übertrieben? Ich fand das angemessen. Der Preis für das künstlerische Lebenswerk gilt ihrem Leben, ihrer künstlerischen Haltung, ihrem ethischem Bewusstsein und dem daraus resultierenden Filmwerk, dass sie, die Schnittmeisterin, im Kollektiv mit anderen, hergestellt hat.
1957 in Halle an der Saale geboren, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, auch zur Musikschule, um das Geigenspiel zu erlernen, was wohl selbstverständlich erscheint, wenn der große Sohn der Stadt Georg Friedrich Händel heißt. Schulferien und Festtage verbrachte sie in Thüringen, auf dem Dorf, bei den Großeltern, mütterlicher- und väterlicherseits. Ihre Eltern verliebten sich als Kinder ineinander, blieben ihr Leben lang zusammen. Beide starben kurz hintereinander, zurückgekehrt an den Ort der Kindheit, in Burgtonna. Gudrun hat sie dort auf dem Friedhof beigesetzt. Gudrun ist der erdhafteste und verlässlichste Mensch, den ich kenne. Das harte bäuerliche Leben der Großeltern, wo sie mit anpacken musste, ließ keinen Raum für Gefühle, die erfuhr sie in der Musik, im Spiel. Aus diesen Komponenten, einem strengen Arbeitsethos und dem Vergnügen am Spiel, dessen Regeln man erlernen kann und beherrschen muss, um frei damit umgehen zu können, setzen sich Arbeitsweise und kollegialer Anspruch der Schnittmeisterin Gudrun Steinbrück zusammen. Die Freiheit des Denkens und auszusprechen, was sie denkt, immer geradeheraus, nicht verschwurbelt, vereinfachen den Arbeitsprozess im Schneideraum mit ihr kolossal.
Nach dem Abitur, im Volontariat des Fernsehstudios Halle, assistierte sie der Schnittmeisterin Petra Heymann, bevor sie an der Filmhochschule in Babelsberg das Regelwerk der Montage im Studiengang Filmschnitt studierte. Es war 1978, als ich Gudrun das erste Mal begegnete, auf der Karl-Marx-Straße in Babelsberg. Sie im zweiten Studienjahr Schnitt, ich im ersten Studienjahr Regie. In der schulischen Hierarchie stand ich unter ihr und obwohl zehn Jahre älter, war ich eingeschüchtert von ihrer imposanten Erscheinung.
Ihr rotes Haar, der porzellanartige Teint Ihrer Haut erinnerte mich an meine Mutter. Vermutlich schenkte ich ihr deshalb ein Paar Schuhe, die ich nicht tragen konnte, weil sie mir zwei Nummern zu klein waren. Schuhe, aus den 1940er Jahren, aus Amerika. Tante Martha hatte sie meiner Mutter geschickt, auch ihre Füße waren dafür zu groß. Spectator-Shoes, die aus zwei kontrastierenden Farben bestanden, die Zehen- und Fersenkappe aus braunem und der Rest aus weißem Leder, auffällige Pumps. In amerikanischen Filmen der 1920er bis in die 1940er Jahre kann man sie leicht entdecken. Vielleicht sah ich in Gudrun eine Schauspielerin, die ich für das Spiel entdecken könnte. Ich hatte noch nie eine Frau gesehen, die eher einem Bild aus einem barocken Gemälde glich, als einer realen Person des 20. Jahrhunderts. Wie Thomas Plenert Gudrun gesehen hat, in den Bildern, die er von ihr gemacht hat. Da verschlägt es einem die Sprache.
Gudruns erste Arbeit: Samstag, Sonntag, Montagfrüh, Regie Hannes Schönemann, Kamera Thomas Plenert, sah ich 1980, auf dem Nationalem Dokumentarfilmfestival, in Neubrandenburg. Ein Film dessen Lässigkeit, im Cinema Verité Stil, ich bewunderte. Gudrun war mit der indischen Studentin Shetna Vora befreundet, deren Abschlussfilm Film FRAUEN IN BERLIN nur die Beteiligten und Kommilitonen aus dem Jahrgang sehen durften. Thomas Plenert hatte ihn gedreht. Das sie den Film versuchten außer Landes zu bringen, um ihn vor der Zerstörung zu retten, sprach sich rasch herum. Ich bewunderte ihren Mut sich aufzulehnen gegen die kleinbürgerliche Weisung einen drei Stunden Film auf das übliche Zeitmaß herunterzuschneiden. Ich bedaure, dass sie beim Sicherstellen erwischt wurden, denn anschließend haben Mitarbeiter des Fernsehens die kleinbürgerliche Weisung erfüllt und abschließend das gesamte Material vernichtet.
Wirklich begegnet sind wir uns nach dem Studium in Berlin. Ich fragte Gudrun, ob sie meinen ersten Kurzfilm im DEFA-Dokumentarfilmstudio über Gundula Schultze schneidet, der ursprünglich ein Kinoboxbeitrag war und den ich nach der Nichtabnahme piratenhaft mit weiterem Material ergänzen konnte. Seitdem haben wir fast alle Filme gemeinsam erarbeitet.
Gudrun hat ein untrügliches Auge und Ohr, um Schönheit, im gedrehten Material zu entdecken, die durch Wahrhaftigkeit entsteht. Intuitiv findet sie den prägnanten Augenblick und klebt Einstellung an Einstellung, die etwas Neues ergeben oder etwas anderes assoziieren. Oft erkannten wir gleichzeitig, was im Material steckt oder inspirierten uns gegenseitig. Wir wechselten die Schneidräume wie Vagabunden, nur diesbezüglich waren wir like a rolling stone. Beide freischaffend, bekamen wir als nicht Festangestellte im DEFA-Dokumentarfilmstudio die Nachtschicht zugeteilt, von abends um zehn bis morgens um sechs. Die Schichtarbeit hat uns nichts ausgemacht, wären da nicht die Kinder gewesen, die ohne unsere Zuwendung am Abend einschlafen mussten. Das schmerzt, noch heute. Der Gewinn war, dass wir die Kinder am nächsten Morgen rechtzeitig wecken konnten, wie andere ordentliche Mütter auch. Wir kamen mit Brötchen vom Bäcker und machten ihnen das Frühstück.
Im Jahr 2000 montierte Gudrun letztmalig für mich analog das Filmmaterial am Schneidetisch. Eine körperlich schwere Arbeit, die die thüringische Bauernenkeltochter, ohne zu klagen verrichtete. Danach trafen wir uns lange Zeit nicht im Schneideraum, in dem Gudrun noch für wenige Jahre analog am Schneidetisch arbeitete, mit Volker Koepp und Thomas Heise, bevor sie sich an den Computer setzte und die neue Technik und vernunftbegabt und rasch erlernte und das spielerisch erweiterte Feld sich zu erobern begann.
Gudrun und Tommy hatten immer ein offenes Haus für die Regisseure, die Freunde waren oder über die Arbeit zu Freunden wurden. Das brachte die Arbeit so mit sich, lebte man doch wochenlang zusammen an fremden Orten, oder in fremden Räumen. Wenn man einverstanden war, mit dem was man gemeinsam herstellte, wenn das, was jeder zum Film beitrug zu einem organischen Ganzen wurde, war am Ende Arbeit und Leben kaum zu trennen, insofern ist der Preis für ein Lebenswerk angemessen, wenn nicht bescheiden.
Der Film VERRIEGELTE ZEIT, in der Regie von Sibylle Schönemann und der Co-Autorenschaft von Hannes Schönemann, Kamera Thomas Plenert, Schnitt Gudrun Steinbrück, wäre nicht dieses organische Ganze, das erschüttert und bezeugt, wenn nicht das schöne und grimmige Menschenleben, Gudrun, Billy, Tommy und Hannes seit den 1970er Jahren in bedingungsloser Freundschaft verbunden hätte.
Filme der Schnittmeisterin Gudrun Plenert, die von einem verschwundenen Land, das nicht „verschwinden will“ erzählen, wurden zu Klassikern und werden gespielt und von den nächsten Generationen staunend wahrgenommen. Beispielsweise einige der schönsten DEFA-Dokumentarfilme von Jürgen Böttcher, dem Maler Strawalde, unserem Meister, wie wir ihn nennen. Von seinen privaten Vorlesungen haben wir mehr gelernt, als von Vorlesungen an der Filmhochschule. Ich erinnere mich, wie Gudrun und ich 1990 vergeblich versuchten, ihn zu überzeugen, einen Spielfilm zu schreiben. Ich glaube, wir knieten regelrecht vor ihm. Jetzt, wo es auch für ihn durch den Zugang zur Filmförderung möglich wurde. Er wollte nur noch malen. Und was für Bilder er geschaffen hat in den letzten 35 Jahren.
Gudrun schneidet noch immer. Sie kann es sich aussuchen, mit wem sie arbeiten möchte. Belebt alte/neue Freundschaften zum Beispiel mit Mario Schneider in Halle, der sie ermutigt und geholfen hat, den fotografischen Nachlass von Thomas Plenert zu archivieren und auszustellen. Mittlerweile archiviert sie nicht nur tausende von Negativen sondern hat mit Vergnügen die Bildbearbeitung für sich entdeckt. Sie kuratiert die erste Einzelausstellung mit Tommys Fotografien für die Alte Kachelofenfabrik in Neustrelitz. Sie nannte die Ausstellung POESIE DES ALLTAGS. Neben den Fotografien sind Filme zu sehen, die Gudrun geschnitten und Tommy gedreht hat. Wenn Sie also einige von Gudruns Arbeiten im Kino wiedersehen möchten, dann machen sie sich auf den Weg nach Neustrelitz. Vom 2. Oktober bis 23. November ist das möglich. Als Bonus gibt es die Fotografien von Thomas Plenert, die die Schnittmeisterin ausgewählt hat.
Liebe Gudrun, liebste Freundin, kluge Arbeitsgefährtin. Manchmal, tatsächlich nur manchmal, dringt eine gewisse bäuerliche Sturheit durch, die ich am besten ignoriere oder gelassen ertrage. Gar nicht so einfach, wenn man selbst, von einem Glas zuviel, ermutigt wurde, zu widersprechen.
Gudrun Steinbrück, Schnittmeisterin, Kuratorin, Mutter, Großmutter, Freundin, Kollegin.
Danke.
Laudatorin: Helke Misselwitz
Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film
Laila Stieler

Laila Stieler
Fotograf: Andreas Domma
Liebe Laila,
ich bin gefragt worden und habe keine Sekunde gezögert. Dir in dieser Runde auf bestmögliche Art und Weise gegenüberzustehen und den Versuch zu unternehmen, dem gerecht zu werden was ja solche Worte sein sollten – nichts Schöneres kann es geben.
Nach der Zusage dann der Schreck – „am besten nicht länger als vier Minuten reden“, hieß es. Wie soll ich das schaffen – um angemessen zu erwähnen wie viel Du GESCHAFFEN hast, was uns verbindet. Gerade das nämlich zu erwähnen ist mir wichtig. Und die Zeit kann gar nicht reichen zu erwähnen, dass Du an über 40 Filmen gearbeitet hast – als Drehbuchautorin – als Dramaturgin, als Producerin. Wir beide haben an 13 Projekten gemeinsam gearbeitet.
Kennengelernt habe ich Dich während unseres Studiums in Babelsberg – Du studiertest Filmwissenschaft/Dramaturgie, ich Produktion. Dort begegneten wir uns aber eigentlich nur flüchtig.
Peter Rabenalt war Deine und unsere Dramaturgie-Ikone, Lothar Bisky war unser Rektor, es war eine spannende und lebendige Zeit die uns das Privileg des Erlebens zweier unterschiedlicher Gesellschaftssysteme erbrachte. Und wir gingen dann unserer Wege in eine neue Zeit.
Du warst Fernsehspielredakteurin beim MDR und wurdest dann Producerin bei der UFA, die damals noch DIE UFA war, die für uns durchaus ein spannender Ausganspunkt gemeinsamer und auch mutiger Arbeiten wurde. Allein zwischen 1993 und 2002 hast Du dort 14 Filme betreut – sie in allen Phasen begleitet – auch in der Besetzung der Rollen. Zahlreiche Deutsche Fernsehpreise, mehrere Grimme Preise und vier Bayerische Fernsehpreise allein nur in dieser Phase.
Unsere erste gemeinsame Arbeit war DIE POLIZISTIN parallel zu NACHTGESTALTEN. Ein Buch der Streifenpolizistin Annegret Held war der Ausgangspunkt für einen – wie sich später herausstellt – ein kleiner Meilenstein in unserer aller Arbeit. Zum ersten Mal bin ich Deiner Kunst begegnet, Rechercheerlebnisse in ein Drehbuch zu bringen, das dann mit großer innerer Haltung von sozialen Brennpunkten, vom Arbeitsalltag der Menschen erzählt. Und schon damals konnte man spüren, was Deine große Kunst ausmacht: Deine Figuren und Deine Dialoge kommen mitten aus dem Leben – sie sind rau, sie sind zart und liebevoll, widersprüchlich und häufig befinden sie sich in der Krise.
Deine Dialoge sind wahrhaftig, weil Du das Leben kennst, ihm begegnest. Auch vor dem Studium. Am liebsten wärst Du Clown geworden, wolltest Schriftstellerin, Regionalwissenschaftlerin, vielleicht auch Journalistin werden. Und du warst in der Produktion – Ein Jahr lang beim VEB Elektrokohle Lichtenberg. Deine Figuren ringen: ob der Autohändler WILLENBROCK; die Mutter, die ihren Sohn aus Guantanamo zurückhaben will, die wunderbare Tina mit ihrem Bäckermobil.
Deine Figuren befinden sich oft in Grenzsituationen. Ihr Alltag ist durch größere politische, gesellschaftliche Umbrüche geprägt. Du erzählst nicht abstrakt, sondern durch eine persönliche Perspektive. Auch in BRIEF AN MEIN LEBEN. Die von Dir hier erzählte Lebenslage einer Frau treibt Marie Bäumer zu einer ihrer fulminantesten Darstellungen überhaupt. Ein Mensch im Ausnahmezustand. Es sind Friseure, Kinder, Rentner, Lehrerinnen, Baggerfahrer – Alle Deine Figuren haben eine innere Stimme. Und oft gibt es in Deinen Geschichten die Trauer und die Komik ganz dicht beieinander.
Ich kann nicht nur über die Kollegin Laila Stieler sprechen – sondern möchte auch unbedingt über die Freundin Laila sprechen, die Du für mich bist – und Andreas weiß es bestimmt einzuordnen.
Unsere gemeinsame Arbeit hat von Anfang an immer damit zu tun gehabt, dass wir uns vor allem ein gemeinsames MITEINANDER schaffen wollten, es aufgebaut und bis heute gepflegt haben. Der respektvolle aber auch vor allem sehr fröhliche Umgang miteinander. Nur so kann man in dieser immer verrückter werdenden Branche überhaupt bestehen und sie ertragen. Oft waren es Spaziergänge bei Euch in Thomsdorf die Ausgangspunkte für Gemeinsames und Neues wurden. Und es ist der Humor, der uns verbindet. Dein unendlich schönes Lachen…
So vielen Menschen hast Du Deine Kunst, Deine Klugheit, Dein Handwerk geschenkt und Deine Haltung in all diese Projekte gebracht: Allen voran natürlich die Arbeiten von Andi – Andreas Dresen. Seit dem Studium verbindet Euch diese unfassbar intensive und schöne Zusammenarbeit – und natürlich: Freundschaft.
Maria Schraders Regie-Debüt LIEBESLEBEN wurde durch Deine Art, den Roman von Zeruya Shalev für sie verfilmbar werden zu lassen ein großes Ausrufezeichen. Im NSU-Dreiteiler zeichnest Du ganz bewusst eine Geschichte aus der Opferperspektive. Das ist eben Deine Haltung. GUNDERMANN. Tja. Fast zwölf Jahre hat es gedauert, auch die letzte Instanz von der Relevanz zu überzeugen, diesen Film machen zu müssen. Die Skepsis von zahlreichen Entscheidungsträgern konnte uns nicht aufhalten.
IN LIEBE EURE HILDE. Auch hier wieder ein kongeniales Beispiel für Deine Art zu arbeiten: biografisch-vorhandenes zu sammeln um es dann mit einer ganz klaren und starken inneren Haltung zu einer Geschichte zu entwickeln, die Fragen an uns alle stellt: Was ist ein gutes Leben? Wofür lohnt es sich zu sein? Ein Film über Mut, über Würde, ein Film über die Kraft der Liebe – und auch darüber, die eigenen Überzeugungen trotz Widrigkeiten nie aufzugeben. „Anstand lohnt sich“. Auch diese Arbeit hat uns extrem an unsere emotionalen Grenzen gebracht. Ausdruck dessen, was wir verfilmt haben.
Gerade sind und waren wir in den letzten Zügen einer wichtigen Arbeit. POLIZEI. So heißt der Film. Eine gemeinsame Arbeit – vielleicht Dein persönlichster Film. In vier Tagen wird der Film in Hamburg seine Premiere erleben. Wieder ist es eine Geschichte über Ungerechtigkeit, über ein Trauma und die Frage: Was passiert, wenn Politik und Gesellschaft unsere Jugendlichen zurücklassen und diese nicht mehr an Demokratie und Gerechtigkeit glauben können. Du bleibst auch hier deinem Wesen treu.
Du hast mal gesagt, am meisten würden Dich Dinge reizen, die nahezu unverfilmbar sind. Lass uns weiter träumen und nachdenken, was unsere innere Wut vielleicht noch ausrichten kann. Mit Deiner Lust und Lebendigkeit, mit Deiner Klugheit kann es uns gelingen. So viele Menschen, liebe Laila, schätzen Dich und auch ich ziehe meinen Hut gerade für Deine so große innere Stärke. Du hast diesen Preis – den für „Herausragende Leistungen im deutschen Film“ – allemal und unendlich verdient.
Von Herzen
Dein Peter
Laudator: Peter Hartwig
Preis für junges Kino
Jan Soldat

Urkunde für Jan Soldat
Fotograf: Andreas Domma
Das Karl-Marx-Stadt der 1980er Jahre war ein Ort, den es möglichst bald zu verlassen galt. Hatte man das geschafft, staute sich aus der geografischen und zeitlichen Distanz heraus bald so etwas wie Sentimentalität, auch schlechtes Gewissen an. Besuchte man den Geburtsort dann wieder, verpuffte diese Anhänglichkeit erneut. Und doch nicht ganz: es gab die Familie und es gab den Freundeskreis. Dieser dezimierte sich zwar weiter und verstreute sich global. Aber es gab noch immer starke gemeinsame Energien, die weiter schwangen und trotz allem Neues entstehen ließen. Nach 1990, als die Stadt endlich wieder Chemnitz heißen durfte, setzte der massenhafte Wegzug erst so richtig ein. Die marode Industrie wurde privatisiert und ausverkauft. Zirka 100.000, vor allem junge Menschen, gingen fort. Einige Mitstreiter hielten aber durch, mehr noch, sie stemmten sich dem Niedergang, der ja nicht nur ein struktureller, sondern vor allem ein moralischer war, entgegen. 1991 etwa gegründete sich die Chemnitzer Filmwerkstatt. Von dort hörte ich den Namen von Jan Soldat zum ersten Mal - ein Name, der wie ausgedacht klang. Meine Freunde Ralf und Lutz schwärmten von den Filmen dieses jungen Mannes. Sie seien formal ungewöhnlich und inhaltlich radikal - aber auch immer auf eine merkwürdige Weise, nun ja ... lustig sei vielleicht das falsche Wort. Als ich dann KOMMISSAR KRESCH UND DER FUCHS VOM POSTHOF oder GESCHWISTERLIEBE endlich sehen konnte, war auch ich begeistert. Seit meinem Weggang im Jahr 1988 stellte sich plötzlich das schöne Gefühl ein, dass in Chemnitz wirklich etwas weiterging. Dass sich etwas aus dem bizarren Humus dieses Ortes fortentwickelte. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis ich Jan dann persönlich traf. Seither beobachte ich seine Arbeit, oft aus räumlich weiter Entfernung, immer aus emotional höchstmöglicher Nähe.
Wenn heute hier an Jan Soldat der Preis der DEFA-Stiftung für junges Kino verliehen wird, so schließt sich ein Kreis. Sollte jemand verwundert fragen, worin denn nun die filmischen Verdienste des Preisträgers für das deutsche Kino liegen, so würde ich damit in einem kurzen Satz antworten. Seine Filme suchen ihresgleichen. Jan ist mit ihnen bislang ziemlich allein geblieben. Dieser Preis geht zwar namentlich an ihn, sollte aber auch als Ermutigung für alle jungen, filmisch Kreativen verstanden werden. Zu oft bremst Angst Kreativität aus: Angst, sich zwischen alle Stühle zu setzen, damit Reputationen zu verspielen, Gremien zu verschrecken und sich damit aus dem System der Filmförderung zu katapultieren. Doch Kunst stirbt durch Kalkül. Wer glaubt, es Vielen recht machen zu müssen, wird schwerlich zu sich selbst finden.
Kalkulierendes Denken liegt Jan fern. Es ist ja kein Zufall, dass er seine Filme im Selbstauftrag dreht. Nie hat er so etwas wie eine Karriere geplant. Er denkt in anderen Kategorien, dreht einfach Film auf Film. Wobei dies ja alles andere als einfach war und ist. Nein, ich werde jetzt keine Vergleichsgrößen anführen, ich werde keine Klassiker nennen, in deren Tradition sich Jan Soldat möglicherweise bewegt. Nur so viel: Ich bin mir sicher, dass seine Filme noch lange Bestand haben werden ... sollte unser Planet noch etwas durchhalten. Denn sie sind Seismografen von Einsamkeit und Sinnsuche, sie begeben sich mitten hinein in Orte und Denkweisen, die uns im ersten Moment höchstmöglich fremd erscheinen mögen. Doch selbstverständlich hat dies alles sehr wohl mit uns zu tun, sei es auch noch so unbequem, was wir da zu sehen bekommen. Jan spürt mit seinen Arbeiten den seelischen Verwerfungen des 21. Jahrhunderts nach, nicht mehr und nicht weniger. Es geht ja nicht um Provokation oder um das Produzieren von Skandalen. Wer ihm dergleichen unterstellt, hat wenig verstanden.
Es war der große Förderer und Analyst eines „Anderen Kinos“ Amos Vogel, der 1974 in seinem Grundlagenwerk „Film als subversive Kunst“ darauf verwies, dass einige Filmemacher „... auf beschwörende Weise Lichtzeichen in der Finsternis geben; sie zeigen uns die Auswirkungen des Terrors und die Möglichkeiten der Liebe. Wenn dies einigen Menschen nicht angenehm ist, kann man dies nicht dem Künstler anlasten.“ Jan Soldat gehört zu denjenigen, die die Räume der Imagination im Sinne Vogels erweitern und mit der Fackel des Kinos zum Glühen bringen. Und wenn wir Chemnitzer oder Karl-Marx-Städter auch niemals unserer merkwürdigen Heimat entkommen werden, so warst Du doch, lieber Jan, in Wien, wo Amos Vogel 1921 geboren wurde, eine ganze Weile lang gut aufgehoben. Mach bitte weiter, wo auch immer, derzeit in Berlin.
Laudator: Claus Löser
Programmpreis
Latücht - Film und Medien e.V.

Das Latücht-Team aus Neubrandenburg
Fotograf: Andreas Domma
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinofreundinnen und -freunde sowie DEFA-Begeisterte,
an manchen Orten spürt man die Magie des Films nicht nur auf der Leinwand, sondern in jedem Detail eines Kinos. Bei diesem hier klingt schon der Name reizvoll, steht er doch plattdeutsch für Laterne – und seit fast 30 Jahren für aufregende Kinostunden im neuromantischen Kirchenschiff und für Open-Air-Kino, auch bei steifer Brise. Für schmackhafte Gourmet & Film-Abende, für Lesungen, Podien, Workshops, Kinder- und Jugendmedienarbeit und für das europäische Filmfestival DokumentART… kurz: Um und in dieser ehemals dem Heiligen Joseph gewidmeten Schnitterkirche wird Kino mit Herz, Charakter, einer Prise Wahnsinn und echtem Gemeinschaftsgeist gelebt.
Doch dieser Ort ist nicht nur ein denkmalgeschützter Bau, sondern ein lebendiges Kollektiv. Seine Betreiberinnen und Betreiber beweisen täglich, dass Kino Teamarbeit ist: Alles wird gemeinsam angepackt, diskutiert, gelöst und gefeiert – die wahren Stars stehen oft hinter den Kulissen!
Seit Jahren kooperiert dieser mecklenburgische Film- und Medienverein mit der DEFA-Stiftung – ein Zusammenspiel aus Kultur und kreativem Widerspruchsgeist. Seine Defa-Filmreihen sind legendär – genauso wie die Filmgespräche mit Rüdiger Weber. Hier begegnen einander Klassiker und junges Publikum, hier werden neue Filmschätze gehoben und alte Erinnerungen lebendig gehalten. Hier hat Kino ein Zuhause für anspruchsvolle Geschichten und ist ein Treffpunkt für Generationen – ein Kino, das dank mobiler Projektionstechnik auch über die umliegenden Dörfer fahren kann.
Ich bitte um kräftigen Applaus für das Team:
- Für Holm Henning Freier, geschäftsführender Vorstand und Programmkurator.
- Für Uta und Thomas Zellmer aus dem Vorstand.
- Für Susanne Bolze, Veranstaltungsmanagerin.
- Für Rita Schönfeld, seit einem Vierteljahrhundert Buchhalterin und gute Seele des Kinos.
- Für Ingrid Teßmann, ebenso lange ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende.
- Und nicht zuletzt für die tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung der gut 250 Vereinsmitglieder.
Sie alle beweisen gemeinsam, dass es zum Betreiben eines engagierten Kinos nicht nur Routine braucht, sondern auch Herzblut und Engagement, das man nicht kaufen, aber mit einem Preis würdigen kann. Heute ehren wir das Kino Latücht, den filmischen Leuchtturm Neubrandenburgs, mit dem Programmpreis der DEFA-Stiftung!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung! Mögen die Lichtzeichen des Latücht nie erlöschen!
Laudatorin: Katrin Schlösser
Programmpreis
Trickfilmkollektiv „Talking Animals“

Die Talking Animals
Pauline Kortmann, Sonja Rohleder, Jost Althoff, Gregor Dashuber, Jan Koester und Milen Vitanov. Fotograf: Andreas Domma
Wenn Sie „Talking Animals“ – also: Sprechende Tiere – in die Google-Suche eingeben, schlägt Ihnen der Suchdienst direkt die automatische Vervollständigung „in der Bibel“ vor, wo es scheinbar genügend davon gibt, um eine eigene Kategorie zu begründen. Ein weiterer Vorschlag ist „in Trickfilmen“ – und da kommen wir der Sache schon näher. Denn die Talking Animals, die wir heute ehren möchten, sind ein Kollektiv, dass sich zusammengefunden hat, um Animationsfilme herzustellen.
Es sind die 2000er Jahre. Ein guter Jahrgang der Filmuniversität Babelsberg, seinerzeit noch unter dem Namen HFF Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg bekannt. Den geschützten Raum der Filmhochschule – eine Art Biotop, in dem man sich in aller Ruhe und weitestgehend frei von finanziellem Druck entwickeln und experimentieren konnte – haben sie verlassen. Man bewegt sich in der Berliner Film- und Kunstszene, hat jede Menge Ideen und noch mehr Idealismus. Doch den Schwung zu bewahren, ist schwer, wenn man alleine zuhause sitzt und an Projekten arbeitet. 15 Absolvent:innen, die sich alle gut kennen, beginnen, sich einmal die Woche in einer Kreuzberger Bar zu treffen.
Dort entsteht die Idee: Gemeinsame Räumlichkeiten sollen her. Ein Ort, wo man Ideen, Wissen und Freude an der Arbeit teilen, wo man zusammen – aber auch getrennt – arbeiten kann, wo man im Verbund frei ist. Das Bezirksamt Lichtenberg hilft, günstige Räume zu finden, frisch renoviert, und mit einem „Fuffi“ pro Person und Monat selbst für Filmkünstler erschwinglich. Fehlt nur noch ein Name für dieses Sammelsurium an Nachwuchstalenten. Mehrere A4-Seiten hatte man schon vollgeschrieben, aber das Richtige war noch nicht dabei gewesen.
Auf einer Autofahrt nach Potsdam im Jahr 2009 hatte Samuel Weikopf dann die zündende Idee: Wann immer er Branchenfremden von seiner Arbeit als Animator erzählte, kam die sinngemäße Frage „Ach, mit so sprechenden Tieren und so?“ Angelehnt an die Band „Talking Heads“ hatte das Kollektiv also plötzlich einen Namen: Talking Animals.
Wer bei einem Kollektiv an Künstlergruppen wie die um Lars von Trier denkt, die ein Manifest verfassen und anschließend nackt durch den Wald laufen, liegt nur halb falsch. Bei den Talking Animals gab es nämlich kein Manifest. Aber ein paar Regeln: Allgemeine Entscheidungen für die Gemeinschaft werden demokratisch getroffen. Innerhalb von Projekten wird eine Hierarchie festgelegt, die nach der Fertigstellung wieder aufgelöst wird. Jeder kann Projekte annehmen, und wer immer auch Lust hatte sich daran beteiligen. Bei Folgeaufträgen hatte das ursprüngliche Team den Vorrang. So entstanden…. Kurzfilme, Image-, Erklär- und Werbefilme, Musikvideos, Installationen, experimentelle Filme. In Mengen und mit durchaus illustren Auftraggebern. In allen denkbaren Animationstechniken und Stilen. Und mit allerlei Auszeichnungen prämiert. Von Autorenfilm bis Auftragsarbeit, nicht unpolitisch, aber auch nicht aktivistisch. Diese breite Aufstellung war eine Stärke.
Mit der Zeit verändert sich die Zusammensetzung des Kollektivs, nicht zuletzt, weil die 3D-Animatoren investieren müssen und sich mit dem Visual Effects und Animationsstudio LUMATIC selbständig machen. Auch wird es schwerer, sich künstlerische Räume und Freiräume zu erkämpfen und sich dabei nicht zu verschleißen. „Ungebräunte Leute in alten T-Shirts“ nennt Jan Köster – einer der Gründer – das. Er sagt auch, die Talking Animals seien wie eine „alte Band, die man irgendwie nicht auflösen kann.“ Denn bevor Zweifel kommen, kommt der nächste spannende Auftrag und man findet neu zusammen.
Für die „Animals“ kommt der DEFA-Stiftungspreis zu einer Zeit in der man nicht nur als Trickfilmer aufgrund der rasant fortschreitenden Entwicklung von Künstlicher Intelligenz durchaus an der Zukunft seiner Arbeit zweifeln kann. Ich persönlich hoffe, dass er nicht zum Schlussstein, sondern zum Schwungrad für großartige künftige Projekte wird. Herzlichen Glückwunsch zum Programmpreis 2025 der DEFA-Stiftung.
Laudator: Till Grahl
Programmpreis
KiKiLi – Kinderkino im Lingnerschloss

Das KiKiLi-Team
Jana Endruschat, Peter Fürst, Thomas von Burski und Sylke Gottlebe. Fotograf: Andreas Domma
Im letzten Jahr stand die wunderbare Autorin und Szenaristin, Christa Kożik, hier oben auf der Bühne und erhielt den Preis der DEFA Stiftung für ihr künstlerisches Lebenswerk. Sie schrieb u.a. das Drehbuch für den DEFA-Kinderfilm MORITZ IN DER LITFASSSÄULE. Im Film haut Moritz von zu Hause ab und hinterlässt seiner Familie den einfachen wie klaren Satz: „Ich bin gegangen. Es hat mir nicht mehr gefallen!“
Mit dieser Konsequenz würden wir Erwachsenen wahrscheinlich auch gerne öfter auftreten, aber dazu sind wir meistens und überwiegend zu gut erzogen. Moritz macht sich jedenfalls auf und findet Zuflucht in einer Litfaßsäule, in der eine sprechende Katze wohnt. Ein im wahrsten Sinne magischer Ort, an dem Phantasie, Lachen und Langsamkeit willkommen sind. „Ein Ort ohne „Seid bereit, immer bereit“.
In einem anderen Film oder einem anderen Leben wäre Moritz vielleicht im KiKiLi – Kinderkino im Lingnerschloss in Dresden gelandet. Denn auch dieser Ort macht Kinder wie Erwachsene glücklich. Ein Ort der anzieht und nicht erzieht. Ein Ort, an dem nicht nur Filme gezeigt werden, sondern wo sich auf lebendige Art und Weise Filmgeschichte mit Zukunft verbindet.
Das Lingnerschloss blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Ein besonderes Kapitel begann in den 1950er Jahren als das Haus umgestaltet und im ersten Obergeschoss ein Kinosaal eingebaut wurde. Der historische Kinosaal ist eine architektonische Rarität und wird seit seiner aufwendigen Restaurierung 2014 multifunktional genutzt. Anlässlich des 60. Jubiläums des DEFA-Studios für Trickfilme Dresden im Jahr 2015 initiierte Peter Fürst das Programmformat „KiKiLi – KinderKino im Lingnerschloss“. Seit 2017 wird es von Sylke Gottlebe gemeinsam mit Jana Endruschat, Simone Lade, Yulia Penner, Thomas von Burski und vielen weiteren Ehrenamtlichen getragen. Sie alle sind das Herz dieses Ortes: Sie planen Programme, moderieren, projizieren und schenken dem Publikum im historischen Saal Lebendigkeit, Wissen, Freude und vor allem Filme.
Die Vermittlung von Filmgeschichte – insbesondere die Pflege der Dresdner Trickfilm-Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF) – bildet einen festen Bestandteil der Programmgestaltung. Auch sorbisches, tschechisches und ukrainisches Kurzfilmschaffen erhält Raum und eröffnet den Zuschauerinnen und Zuschauern Horizonte. Ob Wunschfilm oder Kistentheater, Kinderfasching oder DEFA-Operettenfilm, Wintergeschichten oder Sommerferienkino – mit seinem Programm schafft das Kino eine dramaturgische und kuratorische Verbindung von DEFA-Trickfilmen und aktuellen Kurzfilmproduktionen. Besonderen Wert legt das KiKiLi-Team auf die Moderation der Filmprogramme, altersgerechte Einführungen und anschließende Filmgespräche, wenn möglich mit Gästen.
Veranstaltungen wie die Buchpremiere zu Günter Rätz’ Von der Hand zur Puppe mit dem Regisseur persönlich, oder die Matineen für Trickfilmgrößen wie Hanna und Peter Fürst oder Walter Später zeigen: KiKiLi ist nicht nur ein Kino. Es ist ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird, an dem Erinnerungen bewahrt und zugleich neue geschaffen werden.
Und natürlich findet auch MORITZ IN DER LITFASSSÄULE im Programm einen Platz. Christa Kożik hat stets betont, dass ihre Geschichten für die sind, die mit drei Augen sehen können. An einem Ort wie dem KiKiLi besteht die Chance, sein drittes Auge zu nutzen oder es wiederzuentdecken. Ich bin mir sicher, wäre Moritz anstelle in der Litfaßsäule im KiKiLi gelandet, dann hätte er beim Gehen folgende Nachricht hinterlassen: „Ich komme wieder. Es hat mir gefallen!“
Herzlichen Glückwunsch!
Laudatorin: Nicola Jones
Fotogalerie

Stiftungsvorstand Stefanie Eckert wies in ihrer Eröffnungsrede auf die zahlreichen Aktivitäten im Konrad-Wolf-Jahr hin. Fotograf: Andreas Domma

Eine Jury um Dorett Molitor, Till Grahl, Sylke Gottlebe, Claus Löser, Nicola Jones und Katrin Schlösser sowie Klaus Schmutzer und Conny Klauß (beide nicht im Bild) entschied über die Preise der DEFA-Stiftung. Fotograf: Andreas Domma

Kameramann Karl Farber feierte auf der Preisverleihung zugleich seinen 80. Geburtstag. Fotograf: Andreas Domma

Die DEFA-Stiftungsratsvorsitzende Katrin Schlösser hielt die Laudatio für die ersten Preisträger des Abends. Fotograf: Andreas Domma

Holm Henning Freier, Geschäftsführer des Film- und Medienvereins Latücht in Neubrandenburg, bedankte sich im Namen des Teams. Fotograf: Andreas Domma

Rund 400 Gäste besuchten die Verleihung und ließen die Veranstaltung zum großen DEFA-Familienfest werden. Fotograf: Andreas Domma

Till Grahl, Leiter des Deutschen Instituts für Animationsfilm, würdigte die zweiten Programmpreisträger. Fotograf: Andreas Domma

Die Auszeichnung ging an das Trickfilm-Kollektiv Talking Animals aus Berlin. Fotograf: Andreas Domma

Jurymitglied Nicola Jones von der MOIN-Filmförderung hob in ihrer Laudatio die Verdienste der dritten Programmpreisträger hervor. Fotograf: Andreas Domma

Das Team des KiKiLi - Kinderkino im Lingnerschloss freute sich sehr über den Preis. Fotograf: Andreas Domma

Der Regisseur Jan Soldat erhielt den Förderpreis für junges Kino. Fotograf: Andreas Domma

Filmjournalist Claus Löser hielt die Laudatio. Fotograf: Andreas Domma
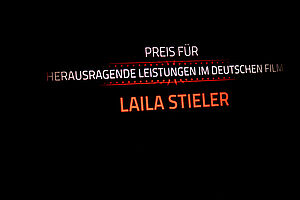
Den Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film erhielt die Autorin Laila Stieler. Fotograf: Andreas Domma

Erster Gratulant: Laudator Peter Hartwig. Fotograf: Andreas Domma

Regisseurin Helke Misselwitz hielt die Laudatio für ihre Freundin und Weggefährtin Gudrun Steinbrück-Plenert. Fotograf: Andreas Domma

Sichtlich gerührt bedankte sich Gudrun Steinbrück-Plenert für die Auszeichnung. Fotograf: Andreas Domma

Stefanie Eckert gratulierte Gudrun Steinbrück-Plenert. Fotograf: Andreas Domma

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends. Fotograf: Andreas Domma

Für den musikalischen Rahmen sorgten Studierende der HfS Ernst Busch mit dem Pianisten Nikolai Orloff. Fotograf: Andreas Domma

Konrad Wolf 100. Fotograf: Andreas Domma

Durch den Abend führte Linda Söffker. Fotograf: Andreas Domma
2025

