Hans-Erich Busch
Produktionsleiter
* 7. Juni 1945 in Rostock
Biografie

Hans-Erich Busch
Fotograf: Henning Zick
Den jungen Hans-Erich Busch zieht es in die Welt hinaus. Er lernt Stahlschiffbauer und will die Welt bereisen. Aber es kommt anders: Über die Filmarbeit lernt er Länder wie die Tschechoslowakei, Polen, die Mongolei, Vietnam, Rumänien, Kuba, die USA, Spanien und Japan kennen. Als studierter Filmökonom dient Hans-Erich Busch der Kunst und bringt im besten Fall Drehbuch und verfügbares Produktionsbudget in Einklang. Dieser Aufgabe stellt er sich als Produktions- und Herstellungsleiter in über 40 Arbeitsjahren bei rund 40 Spiel- und Fernsehfilmen, die ihn mit vielen Regisseurinnen und Regisseuren zusammenbringen.
Hans-Erich Busch wird am 7. Juni 1945 in Rostock geboren. Seine Mutter ist Fremdsprachenkorrespondentin, sein Vater Möbeltischler und Zimmermann. Auf der Suche nach einer „lebenswerten, sicheren“ Zukunft flüchten die Eltern mit ihrem kleinen Sohn 1949 nach Schweden. Dort trennen sie sich. 1951 kehrt der inzwischen schulpflichtige Hans-Erich nach Deutschland zurück und lebt fortan bei den Großeltern in Gnoien in Mecklenburg. Ab September 1952 besucht er die dortige 10-klassige polytechnische Goethe-Oberschule, wird Mitglied der Jungen Pioniere, dann der FDJ und ab 1956 der Jungen Gemeinde in der evangelischen Kirche, die auch kulturell und musikalisch seinen Horizont erweitern. Erste Filmeindrücke verschaffen ihm im Kino des Gnoiener Ballhauses Filme wie DER UNTERTAN (1951), DIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK (1953), POLE POPPENSPÄLER (1954), SCHLÖSSER UND KATEN (1956), VERWIRRUNG DER LIEBE (1959), NACKT UNTER WÖLFEN (1962), aber auch DER STILLE DON (1957/58), TSCHAPAJEW (1934) und FANFAN, DER HUSAR (1952).
Um den Argrarkreis in Mecklenburg verlassen und mehr von der Welt erleben zu können, geht Hans-Erich Busch nach Abschluss der Schule nach Warnemünde und bekommt auf der Warnow-Werft 1962 die Chance auf eine Ausbildung zum Stahlschiffbauer mit Abitur. Im dritten Lehrjahr kommt es zu einer Begegnung mit Studierenden der Deutschen Hochschule für Filmkunst, die seine Lebenspläne in eine andere Richtung lenken. Er bewirbt sich, fast 20-jährig, an dieser Babelsberger Hochschule (1969 umbenannt in Hochschule für Film und Fernsehen der DDR, heute Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF), besteht die Aufnahmeprüfung und absolviert ab September 1965 ein Studium in der Fachrichtung Filmproduktion, dass er 1969 als Diplom-Filmökonom abschließt. Frau und Kind leben weiterhin in Warnemünde, und so müssen 190 Mark Stipendium für Unterkunft, Verpflegung und die zweiwöchentlichen Heimreisen ausreichen. In den Semesterferien verdient Busch zusätzlich Geld als Stauer im Überseehafen Rostock. Um das Stipendium aufzubessern und die Familie zu unterstützen, arbeitet er auch als Aufnahmeleiter für kurze Musikfilme beim Ostseestudio Rostock, die für das 1969 beginnende zweite Programm des DFF entstehen.
Das Studium in den Fachgebieten Filmproduktion (Prof. Günter Althaus, Gerhard Knopfe) und Filmdramaturgie (Prof. Peter Rabenalt) wird Busch als prägend für seine spätere Arbeit als Produktionsleiter bezeichnen: Drehbuch und verfügbares Produktionsbudget müssen in Zusammenarbeit mit einem großen Team (damals Kollektiv genannt) von Spezialisten und vorausschauend in Balance gebracht werden, und zwar immer wieder neu, da jeder Film eigene Herausforderungen stellt und angepasste filmische Lösungen verlangt.
Nach dem Studium geht Hans-Erich Busch wieder nach Rostock zu seiner Familie. Als Assistent und Produktionsleiter im Ostseestudio Rostock, Zweigstudio des DFF, beteiligt er sich zwischen 1969 und 1972 an der Herstellung von Fernsehspielen und Theaterübertragungen aus den Stadt- und Staatstheatern in Rostock, Greifswald und Schwerin, sowie an den Sendereihen „Visite“, „Im Logbuch der Seefahrt geblättert“, „Der Fernsehkoch“ und „Der Fischkoch“. Nach vier ersten Berufsjahren in Rostock wächst in ihm der Wunsch, sich an größeren Spielfilmproduktionen und möglichst auch international zu beteiligen.
Dabei hilft, dass sein früherer Kommilitone Bernd Wilkening, der mit seinem Vater Prof. Dr. Albert Wilkening, dem damaligen Hauptdirektor des DEFA-Studios für Spielfilme in Babelsberg, ein erfolgreich verlaufendes Gespräch arrangieren kann. In der Folge verabreden Gert Golde (damals Direktor für Produktion und später letzter Generaldirektor des Spielfilmstudios) und er ein Probejahr, in dem Busch das Studio kennenlernt und die Studioleitung seine Befähigung überprüft. Unterkunft findet er zunächst im Gästehaus des Studios. Erst fünf Jahre später kann ihm, gemeinsam mit seiner neuen Familie, eine Wohnung in einem Potsdamer Neubaugebiet nahe dem Studio vermittelt werden.
Als eine Art Hospitant beginnt Busch 1973 bei Herbert Ehler - einem etablierten Produktionsleiter (ICH WAR NEUNZEHN, GOYA und ABSCHIED) - zur Zeit der Vorbereitungsarbeiten von DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ seine Arbeit in Babelsberg. Es folgt eine kleinere organisatorische Aufgabe mit dem Prager Regisseur Zbynek Brynych, der einige Motive seines Films WELCHE FARBE HAT DIE LIEBE? (1973) an der Ostsee dreht. Bei ALWIN AUF DER LANDSTRASSE (R: Georg Leopold, 1974) einem Kinderfilm im Auftrag des DDR-Fernsehens, vertritt Busch als erster Aufnahmeleiter schon zeitweilig den Produktionsleiter.

Ein erstes über die Schulter schauen bei der DEFA: DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ (R: Konrad Wolf, 1973) Fotografen: Wolfgang Bangemann, Alexander Kühn

Die erste eigene DEFA-Filmproduktion: EINE PYRAMIDE FÜR MICH (R: Ralf Kirsten, 1975) Fotograf: Wolfgang Ebert
1974 startet Buschs erste eigenständige Produktionsleiter-Aufgabe. Von der seit 1951 amtierenden Produktionsleiterin Anni von Zieten übernimmt er den Mitarbeiterstab und beginnt mit den Vorbereitungen für den Film EINE PYRAMIDE FÜR MICH (R: Ralf Kirsten), der den Bau der Talsperre in Sosa 1948 bis 1950 als erstes DDR-Jugendprojekt schildern. Für die aufwendigen Vorbereitungen und Dreharbeiten dieses historischen Films kann er sich auf die versierte Assistenzregisseurin Doris Borkmann, den einfühlsamen Kameramann Hans-Jürgen Kruse und den filmerfahrenen Szenenbildner Dieter Adam stützen. Eine der größten Dekorationen wird die Baustelle, die in einem stillgelegten Steinbruch im Erzgebirge eingerichtet wird. Dazu müssen 1.000 junge Frauen und Männer als Komparsen gefunden werden, letztere ohne lange Haare und Bart, 1973 auch in der DDR ein schwieriges Unterfangen. Die NVA (Nationale Volksarmee) lehnt Filmarbeiten ihrer Soldaten ab. Busch findet schließlich die vielen Männer mit kurzgeschorenem Haar bei einem filminteressierten General eines Bezirkskommandos der Bereitschaftspolizei und dazu auch deren eigenen Fuhrpark, Zelte und Versorgung. Offiziell macht die Truppe eine Übung in der Nähe des Drehortes und bevölkert in von der Kostümabteilung patinierter Bauarbeiterkleidung die Film-Baustelle, kostet mehrere Drehtage nichts und hilft auch noch bei weiteren Transporten.
Schon hier wird sich Busch an den alten Produktionsleiterspruch erinnern: „Unmögliches machen wir sofort, nur Wunder dauern etwas länger“. Dieser Leitsatz wird ihn sein Arbeitsleben lang begleiten und motivieren, um für scheinbar unlösbare Aufgaben einen Ausweg zu finden. Ohne seinen Einfluss bleibt allerdings die Zulassungsverweigerung des fertigen Films durch die Hauptverwaltung Film des Kulturministeriums – „zu wenig Optimismus, 1948 wie 1974 in der Rahmenhandlung“. Deutliche Schnittänderungen, verändertes Neudrehen einzelner Szenen und ein zusätzlich erklärender Kommentar führen zu einer um ein Jahr verspäteten Kinopremiere im Berliner Kino Kosmos.
Die nächste Zusammenarbeit bietet ihm Regisseur Heiner Carow an: IKARUS (1975) nach einem Szenarium von Klaus Schlesinger. Erzählt wird die Geschichte des neunjährigen Mathias, dessen Eltern geschieden sind. Sein Vater vergisst sein Versprechen, ihm zum neunten Geburtstag einen Rundflug zu schenken, so dass Mathias auf der Suche nach seinem Vater allein und enttäuscht auf dem Flughafen landet. Für die Hauptfigur werden aufwendige Castings gemacht, bis unter 5.000 Jungen der elfjährige Peter Welz, später selbst Regisseur, gefunden wird. Wie an der Filmhochschule erlernt und seinem Berufsethos entsprechend, beteiligt er sich von Anbeginn aktiv an der Stab-Zusammensetzung, dem Casting und der Motivsuche in ihrer Korrelation zur Dramaturgie. Vor allem braucht es Einfälle, um die manchmal herausfordernden Drehbuchideen umzusetzen. Für IKARUS sind es u.a. die Luftaufnahmen über Berlin, die wegen des dortigen Flugverbots der Alliierten in Leipzig gedreht werden. Für die Umsetzung der dramaturgisch wichtigen Szenen auf dem Flughafen Schönefeld muss und will vor allem Busch im Interesse des Filmvorhabens nicht aufgeben, eine Drehgenehmigung für einen kleinen Teil des Sicherheitsbereiches um den Flughafen zu erwirken, für den das Ministerium für Staatssicherheit zuständig ist. Durch nicht nachlassendes Drängen gelingt es, die Drehgenehmigung zu erhalten. So kann ein kosten- und zeitintensiver Filmbau vermieden werden, zumal Carow einen Dreh am authentischen Ort vorzieht. Zu einer weiteren Zusammenarbeit kam es zu beider Bedauern nicht mehr.

Dreharbeiten auf dem Flughafen Schönefeld für IKARUS (R: Heiner Carow, 1975) Fotograf: Norbert Kuhröber

Der Traum vom Fliegen: Mathias – gespielt von Peter Welz – in IKARUS (R: Heiner Carow, 1975) Fotograf: Norbert Kuhröber
1977 erhält Hans-Erich Busch einen Festvertrag als Produktionsleiter im DEFA Studio für Spielfilme und beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten für Rainer Simons Film ZÜND AN, ES KOMMT DIE FEUERWEHR. Ein schwieriges Unterfangen, da die Sommergeschichte im Winter gedreht werden muss, um die benötigten Produktionskapazitäten im vierten Jahresquartal, in dem in der Regel weniger gedreht wird, zu nutzen. Grund für die bevorzugten Drehs in den Frühlings- und Sommermonaten ist das nicht sehr lichtempfindliche ORWO-Filmmaterial. Ungünstige Lichtverhältnisse in den lichtarmen Wintermonaten, bei denen auch starke Kameraobjektive nicht ausreichen, führen zu Drehausfällen. Wartezeiten verursachen eine Verteuerung der Produktion. Die durch Nieselregen und Schneefall verursachten Drehunterbrechungen und damit verbundenen Kostensteigerungen schlagen ausnahmsweise nicht zu Buche, da der ganzjährige Betrieb ein zentrales Anliegen der Studioleitung ist. Im Mittelpunkt der Komödie steht die wahre Geschichte der Siebenlehner Feuerwehr, die um die Jahrhundertwende aus Mangel an zu löschenden Bränden selber zündelt, um sich im Anschluss dafür feiern zu lassen. Es wird ein hochkarätiges Schauspielensemble gecastet, Roland Dressel übernimmt seine erste Kameraarbeit für Rainer Simon, Hans Poppe entwirft die aufwendigen Dekorationen für Atelier- und Außendrehs, Werner Bergemann die historischen Kostüme. Eine Besonderheit ist die Arbeit mit Hunderten von Kindern, bei denen besondere Drehzeiten und deren schulischer Unterricht beachtet werden müssen. Die für den Film geplanten Brände erfordern umfangreiche Vorbereitung und den Einsatz von Stuntleuten, um ein mehrmaliges Drehen zu ermöglichen. Und es wird ein leergezogenes Gebäude für das Gefängnis im Braunkohlegebiet gefunden, das vollständig kontrolliert abbrennen darf.
Fast steht eine geplante Szene in Originalräumen des Wasserschlosses Moritzburg vor dem Aus: Die Feuerwehrleute bringen eine selbst gebackene Torte als Dank für die Ehrung durch die Majestät mit, die von einer für die Szene anwesenden Dogge im Nu zerfetzt wird. Der Dreh gelingt Dank eines Ablenkungsmanövers durch Hans-Erich Busch: Er überredet die nervöse Schlossdirektorin während der Aufnahmen zu einem Spaziergang in den umliegenden Grünanlagen. Besondere Drehorte wie Museen und Schlossanlagen will Busch nie „verbrannt“ hinterlassen, um spätere Drehanfragen, auch durch Kollegen, nicht zu erschweren.
Wie so oft gibt es auch am Hauptdrehort Kohren-Sahlis Probleme. Produktionsleiter wie Aufnahmeleiter sind bei historischen Stoffen auch für die Beseitigung von Modernismen wie Straßenlampen, Verkehrsschildern, Straßenpflaster oder Türgriffen zuständig. Um Westfernsehen zu empfangen, sind eine Vielzahl der Hausdächer mit riesigen Fernsehantennen ausgestattet, die abmontiert werden müssen. Kalkuliert werden müssen ebenso neue Antennen, die nach den Dreharbeiten durch regionale Fernsehwerkstätten wieder angebracht und ausgerichtet werden. All das sind Voraussetzungen für die Zustimmung der betreffenden Bewohner. Generell gilt, vor den Dreharbeiten den guten Willen der Anwohner durch Geld und viel Überzeugungsarbeit zu gewinnen.

Regisseur Rainer Simon, Kameramann Roland Dressel und weitere Mitglieder des Filmstabs bei Dreharbeiten für ZÜND AN, ES KOMMT DIE FEUERWEHR (R: Rainer Simon, 1978) Fotograf: Wolfgang Ebert

Aufwendige Szenerie mit historischer Feuerwehr-Ausstattung – im Hintergrund brennt die Gefängniskulisse in ZÜND AN, ES KOMMT DIE FEUERWEHR (R: Rainer Simon, 1978) Fotograf: Wolfgang Ebert
BLAUVOGEL (1979) wird die erste Auslandsarbeit von Hans-Erich Busch - endlich etwas mehr Welt: Es wird in den Karpaten gedreht, das Buftea-Studio in Rumänien ist Dienstleister. Ulrich Weiß (Regisseur und Drehbuch), Otto Hanisch (Kamera), Hans Poppe (Szenenbild) und Busch treffen in Bukarest auf die dortigen Kollegen. Der erfahrene Produktionsleiter Gheorghe Pîrîu wird Buschs engster Partner. Zuallererst fahren sie gemeinsam auf Motivsuche. Eine wichtige Stütze für Busch wird Manfred Peetz, erster Aufnahmeleiter, der schon in Rumänien gearbeitet hatte. Gesucht werden Außendrehorte, die die „Lebenswirklichkeit der Irokesen in den bergigen Wäldern Nordamerikas um 1760 überzeugend in die Karpaten versetzen und für die Dreharbeiten einrichten“. Der gründlich verhandelte Dienstleistungsvertrag (Unterkünfte, Bau- und Ausstattungen, Transporte etc.) wird zunächst von der Studioleitung wegen zu hoher Kosten abgelehnt. Busch sucht nach kostengünstigeren Lösungen: Er findet ein weitaus preiswerteres Hotel vor Ort und es werden Motive - das Leben der Siedlerfamilie Ruster - auf Vorschlag von Ulrich Weiß, der sehr naturverbunden ist, in die ihm vertraute Umgebung von Potsdam verlegt.
Eine Szene mit einem Hirsch, der später von den Irokesen zur Ernährung ihrer Familie getötet wird, verlangt von Busch wieder Verhandlungsgeschick. Eine Jagdlizenz für drei bis fünf Tausend Dollar verbietet sich. Kontakte von Gheorghe Pîrîu ermöglichen ein Gespräch mit dem offiziellen Chef des Jagdwesens der rumänischen Armee (vermutlich aber von Präsident Nicolae Ceaușescu), der einen Hirsch aus einem Jagdgehege für die Dreharbeiten zusichert. Allerdings sind es 350 Kilometer Entfernung, die für das gefesselte und betäubte Tier auf einem Lastwagen eine Tortur wird. Die Dreharbeiten enden trotz vieler unerwarteter Schwierigkeiten erfolgreich.
Anfang 1979 erhält Hans-Erich Busch den Auftrag für die Produktionsleitung des Films DIE VERLOBTE, einer Koproduktion mit dem Fernsehen der DDR. Es wird eine besondere Zusammenarbeit mit den beiden Regisseuren Günther Rücker und Günter Reisch. Grundlage der Filmgeschichte ist die autobiografische Erzählung „Haus der schweren Tore“ von Eva Lippold. Sie schildert die emotional ergreifende Geschichte der Kommunistin Hella Lindau, die trotz furchtbarer Jahre im Zuchthaus ihre innere Würde nicht verliert, von Jutta Wachowiak eindringlich verkörpert. Rücker muss um ihre Zusage kämpfen, da die damals 39-Jährige meint, dass die Rolle durch eine junge Frau gespielt werden sollte. Alle Innenräume werden in Dekorationen in den Babelsberger Ateliers gedreht, Außendrehorte sind der frühere Gefängnisbau in Rathenau, Teile der wilhelminischen Gänge im Potsdamer Rathaus sowie eine alte Wäscherei in Berlin-Köpenick, die alle mit zusätzlichen Bauten und Einrichtungen angepasst werden. DIE VERLOBTE wird ein großer Erfolg, findet internationales Interesse und gewinnt viele Preise, u.a. als einziger DEFA-Spielfilm den Grand Prix beim Festival in Karlovy Vary und fünf Nationalpreise der DDR.

Verschneites, unwegbares Gelände in Rumänien bei den Dreharbeiten zu BLAUVOGEL (R: Ulrich Weiß, 1979) Fotograf: Dietram Kleist

Zum Mitwirken in DIE VERLOBTE (R: Günter Reisch & Günther Rücker, 1980) musste Jutta Wachowiak erst überzeugt werden. Fotografin: Waltraut Pathenheimer
Im Sommer 1980 fliegen der Regisseur Horst E. Brandt, der Kameramann Hans-Jürgen Kruse, der Szenenbildner Erich Krüllke und Hans-Erich Busch zu Vorbereitungen des Films DIE KOLONIE nach Kuba. Dort und auf der Krim sind Außenmotive für die Dreharbeiten geplant. Sie ersetzen die Originalschauplätze in Südamerika - Chile bzw. die Colonia Dignidad als realer Ort bleiben ungenannt - für die Geschichte um die Verbrechen einer von früheren SS-Offizieren geführten KZ-ähnlichen Kolonie. Buschs Neugierde auf die noch unbekannten Drehorte und die Zusammenarbeit mit den Kollegen auf Kuba und der Krim sind eine neue Herausforderung, wie auch die filmwirtschaftlich unsinnige Forderung dieses Regisseurs, alle Szenen chronologisch zu drehen. Die Dreharbeiten auf Kuba, der Krim und in den Ateliers in Babelsberg will Busch trotzdem im Rahmen des verfügbaren Budgets organisieren: Für rund 50 Schauspielerinnen und Schauspieler aus drei Ländern müssen Verträge abgeschlossen, für die Mehrzahl Reisepässe und Visa organisiert werden, dazu die Flüge zu den Drehorten, die Unterkünfte der Crew und Schauspieler, der Einsatz der Dolmetscher, die gesamte Kurierpost zwischen Drehort und Babelsberg, einschließlich des Hinflugs des belichteten Filmmaterials und Rückflugs der kopierten Muster sowie die Absprachen über die jeweiligen Dienstleistungen mit den Filmstudios Jalta und dem Kubanischen Institut für Filmkunst und Filmindustrie. Um die Zusammenarbeit effizient zu organisieren, gelingt es von Beginn an, gemeinsame Arbeitsprinzipien zu verabreden. Er kann sich dabei auf seine vertrauten Aufnahmeleiter Rüdiger Lieberenz und Peter Schlaak verlassen. So werden die gewohnten Tagesdispositionen übersetzt, vervielfältigt und an alle Beteiligten verteilt. Wirtschaftlich halten sich dadurch die Kosten auf Kuba erfreulich im Budget. In der Sowjetunion sendet Oberst a.D. Iwan Iwanowitsch Morosow (der „Eisige“) von der Krim nach den Dreharbeiten eine stark überhöhte Rechnung für die Dienstleistungen vom Filmstudio Jalta. Busch kann beim Vize-Chef der Moskauer Zentrale protestieren und erreichen, dass es keine Differenzen mehr bei der Endabrechnung gibt.
INSEL DER SCHWÄNE (1982) wird Hans-Erich Buschs erste Zusammenarbeit mit Herrmann Zschoche (Regie) und Ulrich Plenzdorf (Szenarium). Kameramann ist Günter Jaeuthe. Erzählt wird die Geschichte von Stefan, der sein beschauliches Dorf am Oderhaff und seinen besten Freund verlassen und sich in einem unfertigen, wie unwirtlichen Neubaugebiet in Berlin mit neuen sozialen Beziehungen zurechtfinden muss. Zschoche ist bekannt für seine sensible Arbeit mit Kinder- und Laiendarstellern. Gedreht wird von September bis Dezember 1981 im gerade entstehenden Neubaugebiet Berlin-Marzahn. Direkt vor Ort werden Wohnungen, Kellerräume, eine Schule und offene Etagen der Rohbauten für die Dreharbeiten angemietet und von Harry Leupold (Szenenbild) eingerichtet. Drehgenehmigungen organisiert Busch in Abstimmung mit dem Baukombinat Berlin, dem Stadtkreis- und den Polizeiverwaltungen. Busch ist hochzufrieden mit der Zusammenarbeit und dem Verlauf der Dreharbeiten. Dagegen wird die Abnahmeprozedur ein Spießrutenlauf mit Folgen. Aufgeputscht durch den sogenannten „Vater-Brief“, der während der Dreharbeiten am 17. November 1981 erscheint, erteilt der Generaldirektor bei der Rohschnittabnahme erste Schnittauflagen. Die Studioabnahme am 19. April 1981 wird „inhaltlich und künstlerisch als gelungen bewertet“. Nur vier Wochen später wird die staatliche Zulassung verweigert, Zschoche wird „eine verstellte Sicht auf unsere Wirklichkeit“ vorgeworfen. Auch die von Plenzdorf erfundene Rock-Gruppe „Ritter, Tod und Teufel“ die mit ihrer von Peter Gotthardt komponierten Heavy-Metal-Musik in den Hochhausskeletten auftaucht, stieß auf Ablehnung seitens der Zensoren. Um seinen Film zu retten, kommt Zschoche Änderungswünschen durch den Leiter der Hauptverwaltung Film Pehnert und des Generaldirektors Mäde nach. Plenzdorf verweigert sich kompromisslos. Busch, der in diese Abnahmeturbulenzen nicht eingeweiht wird, begleitet aber schließlich die Umsetzungen der Korrekturen. Weist auf der einen Seite seine Verantwortung für die Verzögerungen zurück, andererseits verspricht er in einem Brief an den Produktionsdirektor Gert Golde, alles Mögliche zu unternehmen, um die Auslieferungs-Termine einzuhalten. Besondere Aufwendungen verlangten die Vorgaben, die den Schluss des Films betrafen: Wird Windjacke durch Stefan vor dem Sturz in den Fahrstuhlschacht gerettet oder nicht? Der Nachdreh findet fast ein Jahr später statt, die Jugendlichen hatten sich verändert, nicht nur stimmlich, sondern auch äußerlich bis zur Frisur. Die Maskenbildner waren nun besonders gefragt, um die Schauspieler wieder anschlussfähig herzurichten.

Winfried Glatzeder als Journalist Oswaldo Barray in DIE KOLONIE (R: Horst E. Brandt, 1981) Fotograf: Dieter Jaeger

Gewagtes musikalisches Experiment: „Ritter, Tod und Teufel“ in INSEL DER SCHWÄNE (R: Herrmann Zschoche, 1982) Fotografin: Waltraut Pathenheimer
Anschließend übernimmt Busch für drei Kinderfilmproduktionen die Produktionsleitung: DAS EISMEER RUFT (1982) unter der Regie von Jörg Foth, BIBERSPUR (1984) unter der Regie von Walter Beck und GRITTA VON RATTENZUHAUSBEIUNS (1984/85) von Jürgen Brauer. Brauer, ein versierter Kameramann, ist Busch schon aus der gemeinsamen Arbeit an IKARUS und DIE VERLOBTE vertraut. Mit GRITTA realisiert Brauer seine zweite Regiearbeit, ebenso übernimmt er in Doppelfunktion auch die Kamera. Für den Film werden unter Leitung des Szenenbildners Alfred Hirschmeier und seiner Assistentin Gisela Schultze aufwendige Dekorationen im romantischen Stil entworfen und gebaut bzw. Originaldrehorte umgebaut und zum Teil mit Trickmodellen angepasst. Einige Kopien der wunderschönen Entwürfe bekommt Busch zehn Jahre später von Hirschmeier zu seinem Geburtstag geschenkt. Neben Atelierarbeiten wird republikweit an Originalschauplätzen gedreht, so auf Rügen, bei Greifswald und in Memleben. Neben den üblichen Aufgaben eines Produktionsleiters ist bei GRITTA der Einsatz von Ratten eine spezielle Herausforderung. Im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde, erweisen sich Laborratten - eigentlich für die Raubtierfütterung gedacht - für den Filmdreh als geeignet. Einige der Ratten wurden dressiert und an Menschen gewöhnt, so dass am Ende die beringte Königin und Freundin von Gritta „filmreif“ ist. Die von Christa Kożik geschriebene Geschichte um das aufmüpfige und kluge Mädchen Gritta wird ein großer Publikumserfolg.
Da sich die Dreharbeiten für DSCHUNGELZEIT verzögern, betreut Hans-Erich Busch, der im Herbst 1984 schon für Vorbereitungsarbeiten in Vietnam war, Anfang 1985 für einen erkrankten Kollegen die Dreharbeiten für den Vietnam-Teil der Fernsehserie TREFFPUNKT FLUGHAFEN. Das bringt ihm wertvolle Erfahrungen für das Leben und die Arbeit in diesem unbekannten Land ein.
1983 war bei einem Arbeitstreffen in Hanoi die erste Koproduktion eines Kino-Spielfilms zwischen der DDR und Vietnam beschlossen worden. Behandelt werden soll eine Episode um 1949 im vietnamesischen Befreiungskrieg von der französischen Kolonialherrschaft. Auf Grundlage einer Materialsammlung von authentischen Lebensberichten schrieb die Dramaturgin Brigitte Bernert ein Exposé. Erzählt wird die „Geschichte einer kleinen Gruppe Deutscher, die aus der französischen Fremdenlegion zu den Việt Minh („Liga für die Unabhängigkeit Vietnams“) übergelaufen waren. Der Drehstab in Vietnam sowie die Postproduktion in Babelsberg werden paritätisch besetzt und alle Arbeiten sollen gemeinsam erfolgen. Peter Wuss und Banh Bao entwickeln das Drehbuch. Mit einem kompletten Drehplanentwurf reisen Busch und der engste Stab (Regisseur Jörg Foth, Kameramann Günter Jaeuthe, Szenenbildner Peter Wilde, Autor Peter Wuss) im September 1984 über Karatschi (Pakistan) nach Hanoi. Als Dolmetscher begleitet die Gruppe der vietnamesische Kamerastudent Phi Tien Son, ein Freund von Wilde und Busch. Zunächst geht es um ein Kennenlernen aller Teammitglieder und der jeweiligen Arbeitsweise, die zum Teil sehr unterschiedlich ist. Da alle Positionen doppelt besetzt sind, braucht es Zeit, den anderen zu verstehen. Für die deutschen Kollegen birgt das Land neben der faszinierenden Landschaft und Kultur aber auch Tücken in Hinsicht auf das feuchtwarme Klima und die Essgewohnheiten. Aus seinen Erfahrungen wird Hans-Erich Busch einen Arzt und einen Koch für die Dreharbeiten kalkulieren. Heimatliche Lebensmittel werden über den Versorgungsservice der DDR-Botschaft avisiert und eingeflogen. Ein ehemaliger Schiffskoch aus Rostock kommt zum Drehstab und sorgt für gute Stimmung. Währenddessen werden die Drehbuchbearbeitungen zwischen Hanoi und Potsdam hin und hergeschickt, vielfach ohne Annäherung zwischen den Autoren. Das Drehbuch wird schließlich von den Regisseuren unter Mithilfe der Dramaturgin Brigitte Bernert weiterentwickelt und erreicht den Status einer provisorischen Buchfassung, die Voraussetzung für die beiderseits ersehnte Freigabe für die Dreharbeit. Im März 1987 reist der gesamte Drehstab an, das Material erreicht Vietnam per Schiffsfracht. Seinen langjährigen und vertrauten Aufnahmeleiter Rüdiger Lieberenz und den Kameraassistenten und Fotografen Michael Jüttersonke muss Busch mit erheblichem Nachdruck als „Reisekader“ durchsetzen.

Filme für Kinder I: DAS EISMEER RUFT (R: Jörg Foth, 1983) Fotografen: Jörg Erkens, Dietram Kleist

Filme für Kinder II: GRITTA VON RATTENZUHAUSBEIUNS (R: Jürgen Brauer, 1984) Fotografin: Waltraut Pathenheimer
In Vietnam übernimmt der DEFA-Teilstab praktisch die Planung, Organisation und Realisierung der Dreharbeiten, alle Dispositionen werden in Abstimmung ins Vietnamesische übersetzt, vervielfältigt und verteilt. Vietnamesische Besonderheiten führen gelegentlich zu Problemen. Hinzu kommt, dass der vietnamesische Regisseur Tran Vu wegen Krankheit an allen Arbeiten nicht teilnehmen kann, sodass Jörg Foth allein inszeniert. Für ihn eine enorme Belastung. Trotzdem oder deshalb enden die Dreharbeiten neun Tage vorfristig. In Babelsberg wird dann in drei Monaten mit den vietnamesischen Kollegen die Endfertigung einschließlich der vietnamesischen Sprachfassung realisiert. Die Abnahme erfolgt im Januar 1988, die Filmpremiere am 14. April 1988 im Kino International. Für Busch bilden die vielen sehr unterschiedlichen und unerwarteten Erlebnisse, Eindrücke und ungewöhnlichen physischen und psychischen Belastungen der sieben zum Teil monatelangen Arbeitsaufenthalte in Vietnam eine der wichtigsten Berufs- und Lebenserfahrungen.
Wieder eine andere „Welt“-Erfahrung wird Japan: 1988 entstand in Koproduktion zwischen der West-Berliner Manfred-Durniok-Produktion und Herald Ace Inc. Tokio DIE TÄNZERIN mit umfangreichen Dienstleistungen des DEFA-Spielfilmstudios. Der Film erzählt die Geschichte um eine japanisch-deutsche Liebesgeschichte Ende des 19. Jahrhunderts. Busch soll die Dienstleistungen für die Dreharbeiten in Ost-Berlin, im Atelier und im Umland von Saarmund organisieren. Der Stab besteht aus japanischen (Regie Masahiro Shinoda), westdeutschen (Kameramann Jürgen Jürges) und ostdeutschen Kollegen (Szenenbild Harry Leupold, Assistenzregisseurin Evelyn Schmidt). Bei seinem ersten Devisenprojekt kann sich Busch in West-Berlin frei bewegen, stöbert in Buchläden oder geht ins Kino und Restaurant. Die Einsicht in die westdeutsche Förderpraxis und Vertragsgestaltung zwischen Durniok und dem DEFA-Außenhandel offenbart die unterschiedlichen Gehälter für die Filmbeteiligten. Trost für die vergleichbar geringe Bezahlung ist wieder einmal die Möglichkeit, andere Arbeits- und Lebenswelten kennenzulernen. Problematisch bei dieser Produktion sind die vertraglich geregelten Arbeitszeiten, die im Westen bei guter Überstunden-Bezahlung sehr locker ausgelegt werden. Busch erreicht in Absprache mit den Gewerkschafts-Vertrauensleuten auch für die DEFA-Mitarbeiter Ausnahmeregelungen, so dass es zu keinen Produktionsverzögerungen kommt. Das Abschlussfest findet in der Babelsberger Blankschramme statt, bei der Busch vom japanischen Produzenten nach Tokio eingeladen wird - zu der Zeit in den Augen von Busch sicher nur eine freundliche Geste.

Dreharbeiten vor malerischen Landschaften in Vietnam für DSCHUNGELZEIT (R: Tran Vu, Jörg Foth, 1987) Fotograf: Michael Jüttersonke

DEFA-Regisseur Jörg Foth ohne seinen erkrankten Regiepartner Tran Vu am Set von DSCHUNGELZEIT (R: Tran Vu, Jörg Foth, 1987) Fotograf: Michael Jüttersonke
ÜBER DIE GRENZEN (1989) entsteht im letzten Jahr der DDR. Rainer Ackermann, der als Dokumentarfilmer schon an mehreren Friedensfahrten teilnahm, dreht gemeinsam mit seinem Freund und Kameramann Thomas Plenert den ersten Spielfilm, in dem ein Drehteam zwei DDR-Radsportler begleitet. Ende 1988 wird Hans-Erich Busch mit der Produktion betraut. Drehs in der DDR, der Tschechoslowakei und Polen müssen vorbereitet werden, die Ausstattung mit Rennrädern und internationalen Trikots sichergestellt und aufwendige Drehgenehmigungen, u.a. am Grenzübergang Görlitz, verhandelt werden. Die Filmstudios in Łódź und Barrandov unterstützten mit Dienstleistungen, die gegenseitig verrechnet werden. Erstaunlich unkompliziert erhalten Busch und Ackermann eine Genehmigung für eine zehntägige Reise nach London für die Suche nach einem englischen Rennfahrer/Schauspieler. Später wird klar, dass Sportfunktionär Manfred Ewald wie auch Stuidodirektor Hans-Dieter Mäde ein hohes Interesse an dem Friedensfahrt-Film haben. Ohne Erfolg vor Ort hinterlassen die Reisenden eine Such-Annonce, auf die sich eine Woche nach Rückkehr John Bond meldet, der sich als Rennfahrer und Laienschauspieler gut ins Team einbringt und ein Freund für Busch wird.
Im August 1989 erreicht Hans-Erich Busch überraschend eine Einladung zum Internationalen Filmfestival in Tokio. Dort ist er im September 1989 neben dem letzten DDR-Botschafter der einzige DDR-Filmschaffende.
Anfang Oktober kommt er in ein Land zurück, das in Auflösung begriffen ist. Busch will sich engagieren, studiert Parteiprogramme und gehört zu den ersten Mitgliedern der sich neu gründenden Sozialdemokratischen Partei (SDP, später SPD der DDR), aus der er jedoch wieder austritt, da ihn alleinige Diskussionen um Karriereaussichten und Wiedervereinigung enttäuschen. Ihn interessieren eher Ideen, die Veränderungen der DDR selbstbestimmt und durch eigene Kräfte ermöglichen sollen. Die Mauer fällt, die Wahlen mit entmutigenden Ergebnissen finden statt und Busch arbeitet. Zunächst: WINTERREISE (R: Yuji Murakami, D/Japan 1990), wieder für die Durniok-Produktion. Eine Arbeit, die ihn nach Tokio, Hiroshima und verschiedene kleine japanische Küstenorte führt. Das Berliner Vereinigungsfeuerwerk am 3. Oktober 1990 verfolgt er am Fernseher in einem Hotel in Tokio, gemeinsam mit Durniok. Er kehrt zurück mit einem bundesdeutschen Reisepass, ausgestellt am 4. Oktober 1990 von der bundesdeutschen Botschaft in Tokio. Den DDR-Reisepass bekommt er zurück mit dem Stempel UNGÜLTIG und der Konsulatsbeamte staunt über die vielen Einreisevisa darin für Länder, in die er nie reisen durfte.

Britischer Gastschauspieler bei der DEFA: John Bond in ÜBER DIE GRENZEN (R: Rainer Ackermann, 1989) Fotografin: Christa Köfer

Dreharbeiten mit großen Tieren: ELEFANT IM KRANKENHAUS (R: Karola Hattop, 1991/92) Fotograf: Günter Jaeuthe
Inzwischen gerät das Studio wie alle staatlichen Einrichtungen in Turbulenzen, auch die Idee von einer selbstverwalteten Filmgesellschaft zerschlägt sich schnell. Die Mitarbeiter werden ab Ende 1990 entlassen oder gehen mit Abfindungen in den Vorruhestand. Busch, inzwischen 45 Jahre alt, bleibt mit vier anderen Produktionsleitern mit Herstellungspflichten noch im Studio und versucht, Filmprojekte zu akquirieren. Er kauft sich einen Computer mit Drehplanungs- und Kalkulationsprogrammen und organisiert für die verbliebenen Kollegen einen Intensivkurs, um auf internationale Arbeitsprozesse vorbereitet zu sein.
1991 werden in Babelsberg insgesamt zwölf DEFA-Eigen-Produktionen und vier Koproduktionsbeteiligungen realisiert. Dazu gehören acht sogenannte Überläuferfilme, die mit 18 Millionen DM finanziert werden. ELEFANT IM KRANKENHAUS (R: Karola Hattop, 1991/92) gehört zu den ersten Filmen, die mit Fördermitteln der Bundesrepublik zustande kommen. Volker Schlöndorff hat inzwischen für den französischen Mischkonzern Compagnie générale des eaux 1992 das Studio übernommen und verspricht, es zu einem europäischen Filmzentrum mit 5.000 Mitarbeitern zu entwickeln. Ein Versprechen, das nie eingelöst wird. Der DEFA-Name wird getilgt.
Busch nutzt seine internationalen Kontakte für das Studio. Ab 1993 arbeitet er mit französischen Regisseuren wie Jacques Doillon (GERMAINE ET BENJAMIN, drei Teile à 45 Minuten, F/D 1993, TV, die erste HDTV-Produktion) und François Dupeyron (DIE MASCHINE, F/D 1994, einem Horrorthriller mit Gérard Depardieu) sowie dem amerikanischen Regisseur Jim Johnston (STAR COMMAND – GEFECHT IM WELTALL, USA/D 1994/95, TV, einem Piloten für eine Science-Fiction-Serie), seine erste Zusammenarbeit mit Hollywood.
Zum 31. Dezember 1995 lässt sich Hans-Erich Busch mit Anspruch auf eine Abfindung und Arbeitslosengeld kündigen. Er geht nach Hamburg, wo er dann auch privat wohnt, und beginnt bei der Produktionsfirma RELEVANT FILM als Herstellungsleiter mit Produktionsleiterpflichten. In den kommenden Jahren leitet Busch die Produktion des Fernsehfilms ZWEI LEBEN HAT DIE LIEBE (1996), und DUMM GELAUFEN (1996/97), FERKEL FRITZ (1997), jeweils unter der Regie von Peter Timm und CHAMÄLEON (Pilotfilm, Buch, Regie, Schnitt Thorsten Näter, 1998/1999) für RTL und Pro 7.
Eine besondere Produktion wird für Hans-Erich Busch als Produktionsleiter das zweiteilige Dokudrama DEUTSCHLANDSPIEL von Hans-Christoph Blumenberg um die Ereignisse der Wiedervereinigung. Hier trifft Busch neben Sir Peter Ustinov, Nicole Hesters, Michael Mendl auch frühere DEFA-Schauspieler wie Peter Sodann und Jaecki Schwarz – jeweils ein Anlass, Erinnerungen an die DEFA-Zeit zu teilen. Das Dokudrama ermöglicht ihm zudem politisch ehemals bedeutsame Drehorte wie das frühere Bonner Büro des Bundeskanzlers und der Sitzungssaal des Politbüros im früheren ZK-Gebäude der SED in Berlin kennenzulernen.
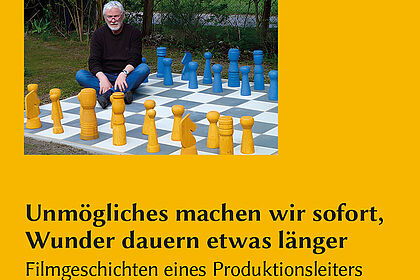
Buchcover der Lebenserinnerungen „Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.“ Foto: Bertz + Fischer Verlag

Bis zu seinem 70. Lebensjahr wirkte Hans-Erich Busch als Produktionsleiter. Fotografin: Ursula Höf
Mit ROSENTRASSE (D/NL 2002/03) von Margarethe von Trotta kommt Busch als Produktionsleiter wieder ein Stück weit nach Hause. Viele Szenen werden in der Dekoration „Berliner Straße“ auf dem Babelsberger Außengelände gedreht. Außerdem führt ihn die Arbeit mit dem ehemaligen DEFA-Szenenbildner Heike Bauersfeld zusammen und er begegnet Jutta Wachowiak, mit der ihn die Arbeit an DIE VERLOBTE verbindet. Erzählt werden die dramatischen Ereignisse 1943, als mutige Frauen vor der Rosenstraße, wo die Gestapo Juden aus „Mischehen“ inhaftiert hatte, um deren Freilassung kämpfen. Es sind Dreharbeiten in New York, Hamburg, Berlin und Oberbayern zu organisieren sowie in den Studios in Babelsberg und der Bavaria, verbunden mit aufwendigen Filmbauten. Ortsansässige Mitarbeiter (Location Manager) bereiten die jeweiligen Drehorte vor. In Babelsberg ist Ulrich Kling, ein ehemaliger Kollege, vertrauter Ansprechpartner.
Immer wieder klingelt bei Busch das Telefon: Bis 2009 arbeitet er als Produktions- und Herstellungsleiter für verschiedene Fernsehproduktionen von Hamburg über Berlin bis München, bis 2015 berät er Filmproduktionen. Mit 70 beendet Hans-Erich Busch sein Arbeitsleben, das ihm seinen Jugendtraum, die Welt zu erkunden, ermöglichte. Gert Golde, Studio-Direktor für Produktion und fast durchgehend direkter Vorgesetzter Hans-Erich Buschs, formuliert seinen Wunsch für die Arbeit der Produktionsleiter so: „Mir sind die Produktionsleiter am liebsten, denen ich dienstlich nur einmal zu Beginn des Films und am Ende der Produktion mit beidseitigen Erfolgserwartungen begegne.“ Darin steckt eine große Freiheit, die Busch sein Arbeitsleben lang im Sinne des jeweiligen Films nutzte.
Verfasst von Dorett Molitor. (Dezember 2024/Januar 2025)
Quellennachweis
Dieser Text entstand auf Grundlage der ausführlicheren Publikation Hans-Erich Busch „Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Filmgeschichten eines Produktionsleiters“ (Schriftenreihe der DEFA-Stiftung, Berlin 2024), an der die Autorin beteiligt war. Die in diesem Text genutzten Zitate stammen aus dieser Publikation sowie aus dem Teilvorlass von Hans-Erich Busch, der in den Sammlungen des Filmmuseums Potsdam bewahrt wird.
Buchtipp: Filmgeschichten eines Produktionsleiters
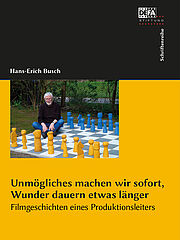
„Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.“
erschienen im Oktober 2024 in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung.
Unter der Überschrift „Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.“ erschienen im Herbst 2024 die Lebenserinnerungen von Hans-Erich Busch in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung im Bertz + Fischer Verlag. Busch schreibt darin über seinen Weg vom Stahlschiffbauer in Mecklenburg zum Produktionsleiter im DEFA-Studio für Spielfilme, wo er mit Regiegrößen wie Heiner Carow, Rainer Simon, Günter Reisch, Günther Rücker oder Herrmann Zschoche zusammenarbeitete. Von Babelsberg ging es hinaus in die Welt: Vertragsgespräche, Vorbereitungen und Drehbegleitungen führten ihn im Laufe seines Beruflebens nach Kuba, Vietnam, Japan, nach Ost-, dann auch nach Westeuropa und in die USA.
DEFA-Filmografie
- Ikarus (1975) - Produktionsleitung | Regie: Heiner Carow
- Eine Pyramide für mich (1975) - Produktionsleitung | Regie: Ralf Kirsten
- Die unverbesserliche Barbara (1976) - Aufnahmeleitung | Regie: Lothar Warneke
- Zünd an, es kommt die Feuerwehr (1978) - Produktionsleitung | Regie: Rainer Simon
- Blauvogel (1979) - Produktionsleitung | Regie: Ulrich Weiß
- Die Verlobte (1980) - Produktionsleitung | Regie: Günther Rücker, Günter Reisch
- Die Kolonie (1981) - Produktionsleitung | Regie: Horst E. Brandt
- Insel der Schwäne (1982) - Produktionsleitung | Regie: Herrmann Zschoche
- Das Eismeer ruft (1983) - Darsteller, Produktionsleitung | Regie: Jörg Foth
- Zille und ick (1983) - Produktionsleitung | Regie: Werner Wolfgang Wallroth
- Biberspur (1984) - Produktionsleitung | Regie: Walter Beck
- Gritta von Rattenzuhausbeiuns (1984) - Produktionsleitung | Regie: Jürgen Brauer
- Hilde, das Dienstmädchen (1986) - Produktionsleitung | Regie: Günther Rücker, Jürgen Brauer
- Dschungelzeit; Ngọn tháp Hà Nội (1987) - Produktionsleitung | Regie: Jörg Foth,
- Grüne Hochzeit (1988) - Produktionsleitung | Regie: Herrmann Zschoche
- Über die Grenzen (1989) - Produktionsleitung | Regie: Rainer Ackermann
- Elefant im Krankenhaus (1991 - 1992) - Produktionsleitung | Regie: Karola Hattop (geb. Wiemann)
- Zeitzeugengespräch: Hans-Erich Busch (2021) - Person, primär | Regie: Ferdinand Teubner, Katrin Teubner
Eine erweiterte Filmografie können Sie unter filmportal.de einsehen.

